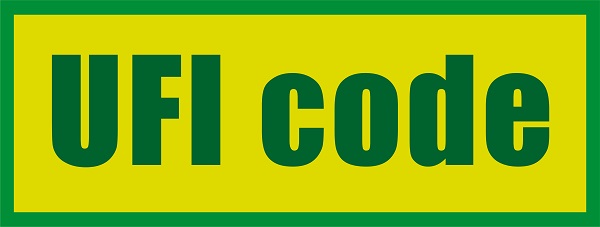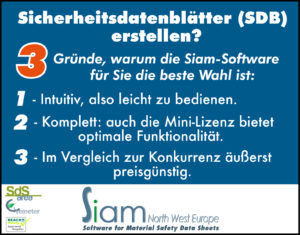Ein umfassender Überblick über die Glyphosat-Debatte – Glyphosat begann als gescheitertes Experiment. Im Jahr 1950 synthetisierte der Schweizer Chemiker Henri Martin es erstmals, um neue pharmazeutische Produkte zu entwickeln, doch die Verbindung war wenig vielversprechend. 75 Jahre später ist Glyphosat zu einem der am häufigsten verwendeten Pestizide weltweit geworden. Es wurde mehr davon verwendet als jede andere landwirtschaftliche Chemikalie, und seit 1974 wurden Milliarden Pfund versprüht, um fast alles anzubauen, von Weizen bis zu Orangen.
Ein Umdenken
Landwirte verwenden Glyphosat aus mehreren Gründen: Es ist im Vergleich zu anderen Herbiziden günstig, einfach anzuwenden und wirkt relativ schnell. Glyphosat wurde 1974 von Monsanto (das 2016 von Bayer übernommen wurde) vermarktet und hemmt das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase (EPSP-Synthase). Dieses Enzym ist im Shikimisäure-Weg für die Synthese aromatischer Aminosäuren in Pflanzen, Pilzen und einigen Bakterien essentiell. Da dieser Weg bei Tieren, auch beim Menschen, fehlt, galt Glyphosat zunächst als ungiftig für sie. „Uns wurde immer gesagt, dass Glyphosat eines der sichersten Pestizide und eines der sichersten Pestizide für die Umwelt ist“, fügt Allen-Stevens hinzu.
Neue Forschungsergebnisse und Rezensionen scheinen jedoch etwas anderes zu deuten. Hunderte von Berichten, die auf einer Vielzahl von Proben und Probanden basieren – darunter Urin, Mäuse und Krebszellen – zeichnen ein immer komplexeres Bild der Auswirkungen von Glyphosat auf Säugetiere, Insekten und letztendlich den Menschen.
Glyphosat und die menschliche Gesundheit
In jedem Biologiebuch heißt es deutlich: Die Zelle ist die Grundeinheit des Lebens. Es ist daher keine Überraschung, dass sich Wissenschaftler dieser grundlegenden Ebene zuwenden, um zu beurteilen, wie Glyphosat den Menschen schaden könnte. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2005 scheint eine der ersten Studien zu den direkten Auswirkungen von Glyphosat auf menschliche Zellen zu sein. Darin berichteten Wissenschaftler, dass die Glyphosatexposition die Lebensfähigkeit der Zellen verringerte und DNA-Schäden in normalen menschlichen Fibroblasten und menschlichen Fibrosarkomzellen verursachte.
Mehrere andere Studien
In den letzten Jahrzehnten wurden in anderen Studien andere Auswirkungen bei unterschiedlichen Dosen von Glyphosat untersucht. In einer Studie aus dem Jahr 2019 untersuchten Forscher, wie Glyphosat allein und in Formulierungen, die Glyphosat enthalten, menschliche mononukleäre weiße Blutkörperchen beeinflusst. Sie fanden heraus, dass Glyphosat allein zwar keine signifikanten DNA-Schäden verursachte, Herbizidformulierungen auf Glyphosatbasis jedoch im Wesentlichen sowohl DNA-Schäden als auch Zelltod verursachten.
In einer anderen Studie verwendeten Forscher einen anderen Zelltyp (menschliche Lymphozyten) und setzten sie unterschiedlichen Konzentrationen von Glyphosat aus. Eine Konzentration stellte die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) festgelegte akzeptable tägliche Aufnahme dar. Das Team beobachtete, dass die Exposition gegenüber Glyphosat zu einer Zunahme von Chromosomenanomalien und der Bildung von Mikrokernen führte. Chromosomenanomalien weisen auf eine direkte strukturelle Schädigung der Chromosomen hin, während eine Zunahme der Mikrokerne auf Fehler bei der Zellteilung hindeutet.
Aufruf an die WHO
Da die Popularität von Glyphosat im Laufe der Jahre zunahm, forderten Regierungen und Gesundheitsbehörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2015 auf, eine gründliche Überprüfung des Pestizids durchzuführen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO hat genau das getan und ist zu einer Schlussfolgerung gekommen, die etwas umstritten war (und bleibt).
Ist Glyphosat krebserregend?
Nach Durchsicht von etwa 1.000 Quellen stufte die IARC Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ ein und ordnete das Pestizid damit in die gleiche Kategorie wie den Verzehr von rotem Fleisch oder die Arbeit in Nachtschichten. Diese Entscheidung basierte auf „ausreichenden“ Beweisen dafür, dass das Pestizid in Tierversuchen Krebs verursacht, und auf „begrenzten“ Beweisen für Krebs bei Menschen bei Exposition in der Praxis. Die IARC-Klassifizierung hob auch „starke“ Beweise dafür hervor, dass Glyphosat genotoxisch ist, was bedeutet, dass es genetisches Material in Zellen schädigen kann.
Völlig unabhängige Berichterstattung
Dieser Bericht basierte ausschließlich auf Daten, die öffentlich verfügbar sind und einer unabhängigen wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen wurden. Daher berücksichtigte die Agentur keine unveröffentlichten, von der Industrie geförderten Studien, es sei denn, sie waren öffentlich zugänglich. Im Gegensatz dazu beziehen Regulierungsbehörden wie die US-Umweltschutzbehörde (EPA) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) häufig unveröffentlichte Branchenstudien in ihre Bewertungen ein. Dieser Unterschied in der Methodik ist einer der Gründe für Meinungsverschiedenheiten zwischen den Agenturen.
Meinungsverschiedenheiten mit EFSA und EPA
Sowohl die EFSA als auch die EPA geben in ihren Bewertungen an, dass Glyphosat wahrscheinlich keine krebserregende Gefahr für den Menschen darstellt. Und auch wenn es in der Art und Weise, wie die einzelnen Berichte beschafft und analysiert werden, Nuancen gibt, ist die Realität so, dass diese widersprüchlichen Schlussfolgerungen eine Atmosphäre des Misstrauens und des Widerstands geschürt haben. „Als immer mehr Informationen herauskamen, die darauf hindeuteten, dass es wahrscheinlich krebserregend war, schien es zehnmal mehr Beweise dafür zu geben, dass dies nicht der Fall war“, sagt Allen-Stevens. Allerdings fügt er hinzu, dass diese Skepsis darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Landwirte in einer Blase leben. „Wir sind sehr anfällig für Dinge wie das, was Bayer uns zeigt, aber ich denke, die Mehrheit der Landwirte hatte das Gefühl, viele Fehlinformationen zu erhalten.“ Er weist weiter darauf hin, dass einige Landwirte zwar nicht glauben, dass Glyphosat krebserregend ist, andere sich jedoch aufgrund der Auswirkungen offenbar dazu entschließen, Glyphosat nicht zu glauben. „Ich glaube, es gibt einen gewissen Teil der Bauerngemeinschaft, der sich einfach nur den Finger ins Ohr steckt und sagt: ‚La la la, das will ich nicht hören, ich kann die Aussicht nicht ertragen, dass ich kein Glyphosat verwenden darf.‘“
Ertrag versus Gesundheit
Dieses Paradoxon ist schwer zu ignorieren. Einerseits bestärken Studien, die Glyphosat mit Gesundheitsrisiken in Verbindung bringen, Tausende erkrankter Landwirte und Gärtner darin, Bayer vor Gericht zu verklagen. Gleichzeitig verteidigen viele Agrarorganisationen und Landwirte das Pestizid entschieden und lehnen Versuche, es zu verbieten, aktiv ab. Landwirte zögern, den Einsatz von Glyphosat einzustellen, da es schwierig, wenn nicht unmöglich sei, ohne Glyphosat die gleichen Erträge zu erzielen. Andere sehen die Situation jedoch anders. „Wir befinden uns mitten in einer Biodiversitäts- und Klimakrise, die gelöst werden muss“, sagte Nick Mole, Policy Manager beim Pesticide Action Network UK. „Es spielt keine Rolle, wie viel wir essen, wenn niemand da ist, der es isst, oder wenn es sowieso unmöglich ist, etwas anzubauen.“
Der Text wird unterhalb des Bildes fortgesetzt

Störung der Artenvielfalt
Die Landwirtschaft ist stark von der Artenvielfalt abhängig. Insekten wie Bienen und Schmetterlinge helfen bei der Bestäubung von Nutzpflanzen, während Bodenorganismen organisches Material abbauen und die Bodenstruktur verbessern. Es wurden jedoch Spuren von Glyphosat gefunden, die viele Bereiche dieses komplexen, aber fragilen Ökosystems beeinträchtigen. Das Pestizid kann die Zusammensetzung und Häufigkeit von Bodenmikroorganismen (Bakterien und Pilze) verändern. Untersuchungen zeigen auch, dass eine Kontamination bei Regenwürmern häufig vorkommt und schwerwiegende Auswirkungen auf deren Überleben, Körpermasse und Verhalten haben kann.
„Was hat den Verlust von 80 % der Insektenbiomasse in den letzten 30 Jahren verursacht?“ fragte Anja Weidenmüller, Biologin von der Universität Konstanz in Deutschland. „Ich denke, es lässt sich nicht leugnen, dass unser intensiver Einsatz von Agrochemikalien dabei eine wichtige Rolle spielt.“
Glyphosat und die Umwelt
Weidenmüller beschäftigt sich mit grundlegenden biologischen Fragestellungen. Sie untersucht das Innenleben sozialer Insektenkolonien – insbesondere Hummeln – und interessiert sich für das Verständnis ihrer Fähigkeit, die Homöostase aufrechtzuerhalten. Hummeln sind auf die von der Kolonie erzeugte Wärme angewiesen, um ihre Brut – die sich entwickelnden Larven und Puppen im Bienenstock – auf einer stabilen Temperatur zu halten, normalerweise bei etwa 30–34 °C. Dies ist entscheidend für die Gesundheit der Kolonie.
Weidenmüller interessierte sich für die Frage, ob Glyphosat das Verhalten der Kolonie und damit deren Bruttemperatur und Überleben beeinflussen könnte. Sie und ihr Team untersuchten dies in einer Studie, in der sie 15 Hummelvölker im Labor hielten und jede Kolonie in zwei Hälften teilten, die durch ein Maschensieb getrennt waren. Die Kolonien wurden täglich auf der einen Seite mit reinem Zuckerwasser und auf der anderen Seite mit der gleichen Menge Zuckerwasser gemischt mit Glyphosat gefüttert. Allerdings fütterten die Forscher die Hummeln über die Zeit hinweg nicht gleichmäßig. „Ich habe ihnen ohne Einschränkungen die gleiche Menge Zuckerwasser gegeben, aber an bestimmten Tagen habe ich die Menge begrenzt, die ihnen zur Verfügung stand“, sagt sie. Diese Strategie war wichtig, um natürliche Stressfaktoren nachzuahmen. Weidenmüller erklärt, dass die meisten Studien Bienen unter perfekten, unnatürlichen Bedingungen mit kontrollierten Temperaturen, konstanter Nahrung und ohne Parasiten platzierten. „Das wird nur dazu führen, dass wir die Auswirkungen übersehen und behaupten, es gäbe keine Wirkung, obwohl es eine sehr erhebliche Wirkung geben könnte“, fügt sie hinzu.
Effekte werden erst bei Stress sichtbar
Ihr Team nutzte eine Wärmebildkamera, um die Nesttemperaturen aufzuzeichnen, die die Temperatur der Brut widerspiegeln. Als die Kolonien zunächst gut ernährt waren, konnten sie keine signifikanten Unterschiede zwischen den mit Glyphosat behandelten Nestern und der Kontrollgruppe feststellen. Die Auswirkungen von Glyphosat wurden jedoch deutlich, als die Kolonien mit begrenzten Ressourcen konfrontiert waren. „Die Bienenvölkerhälften, die Glyphosat ausgesetzt waren, waren im Vergleich zu Bienenvölkern, die nicht mit Glyphosat behandelt wurden, schlechter in der Lage, ihre Temperatur auf einem angemessenen Niveau zu halten“, erklärt sie.
Für Weidenmüller war die Sache klar: Glyphosat schadete zwar nicht direkt dem Überleben, wohl aber der Brut und damit der Kolonie. Vor allem, wenn Bienen Nahrungsknappheit hatten. „Es gab keine Auswirkungen auf das Überleben, also würden wir klassischerweise sagen, dass es ihnen nicht schadet, oder?“ Aber dann muss man länger suchen, um diese subletalen Effekte zu finden“, sagt sie. „Subletale Verhaltenseffekte können wirklich schädlich sein.“
Aufregung um Genehmigung
Wie bei Studien, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt Hunderte von Berichten geschrieben und veröffentlicht, die zeigen, dass Glyphosat bestimmte Aspekte des Überlebens von Insekten beeinflusst. Und gerade weil so viele Studien übereinstimmend belegen, dass Glyphosat nicht so harmlos ist wie einst angenommen, gab es große Aufregung, als das Pestizid für weitere zehn Jahre in der EU zugelassen wurde.
Die Regeln für weitere zehn Jahre Glyphosat
EU-Regulierungsbehörden überprüfen häufig umstrittene Substanzen, um festzustellen, ob sie für die Verwendung in der EU noch sicher sind. Angesichts der zunehmenden Beweise, die die Sicherheit von Glyphosat in Frage stellen, äußerte die Öffentlichkeit besonders lautstark die Möglichkeit eines Verbots des Pestizids. „Es gibt eine Art öffentlichen Druck, den Glyphosatverbrauch zu reduzieren“, sagt Helen MetCalfe, Agrarökologin bei Rothamsted Research im Vereinigten Königreich.
Die EU hat Glyphosat dreimal bewertet. Die letzte Bewertung wurde zwischen 2019 und 2023 von der EFSA und der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) durchgeführt. Beide Behörden kamen zu dem Schluss, dass es derzeit keine wissenschaftliche oder rechtliche Begründung für ein Verbot gibt. Daher war das Pestizid in der EU bis zum 15. Dezember 2033 zur Verwendung zugelassen. Das bedeutet, dass Europäer Glyphosat grundsätzlich verwenden dürfen, wenn auch unter bestimmten Regeln. Abhängig davon, wie die jeweilige nationale Behörde das Problem regelt, kann das Pestizid zur Unkrautvernichtung auf Bauernhöfen, in Gärten und in der Nähe von Eisenbahnstrecken eingesetzt werden. Einige Länder wie Österreich haben Glyphosat für den privaten Gebrauch (z. B. in Gärten) verboten, während Deutschland kürzlich den Einsatz in geschützten Feuchtgebieten, Privatgärten und Kleingärten verboten hat.
Gemischte Reaktionen
Die Entscheidung, Glyphosat nicht zu verbieten, löste gemischte Reaktionen aus. NGOs und Aktivisten widersprachen entschieden und fochten die Genehmigung des Pestizids durch die Kommission im Dezember 2024 vor dem Europäischen Gerichtshof an. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels gab es keine weiteren Entwicklungen. Andererseits feierten Landwirte und Pestizidunternehmen die Ankündigung. Dies ist keine Überraschung, da Landwirte stark auf Glyphosat angewiesen sind. Ein Bericht aus dem Jahr 2019 über 32 Länder zeigt, wie dominant das Pestizid in der europäischen Landwirtschaft ist. Mit 33 % aller Herbizidverkäufe ist Glyphosat eines der am häufigsten verwendeten Herbizide in der Region. Es wird auf 32 % der Weizenfelder, 25 % der Maisfelder und mehr als der Hälfte (52 %) der Rapsanbaufläche angewendet.
Wie wurden Landwirte von Glyphosat abhängig?
Allen-Stevens weist darauf hin, dass es nicht nur günstig und einfach zu bedienen ist, sondern auch noch mehr dahintersteckt. Er erklärt, dass Landwirte dazu ermutigt wurden, sowohl den Einsatz von Pestiziden als auch den Umfang der Bodenbearbeitung zu reduzieren, um die Bodengesundheit zu erhalten und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Bei der Bodenbearbeitung wird der Boden umgegraben, um Unkraut und Schädlinge zu bekämpfen und die Aussaat vorzubereiten. Je mehr getan wird, desto größer ist der Schaden für den Boden. Die Herausforderung besteht darin, dass Landwirte in dem Bemühen, die Bodenbearbeitung und den Einsatz anderer Pestizide zu reduzieren, nach und nach auf Glyphosat angewiesen sind. und ein Ergebnis, das nicht ideal ist. Laut Allen-Stevens. „Es ist ein bisschen so, als würde man Frösche kochen.“ Wir befanden uns plötzlich in einer Situation, in der uns klar wurde, dass wir als Industrie völlig auf dieses eine Pestizid angewiesen sind. Diese Abhängigkeit ist gefährlich. Es gibt offensichtliche Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von Mensch und Umwelt, und dann ist da noch das Problem der Resistenz.
Der Text wird unterhalb des Bildes fortgesetzt
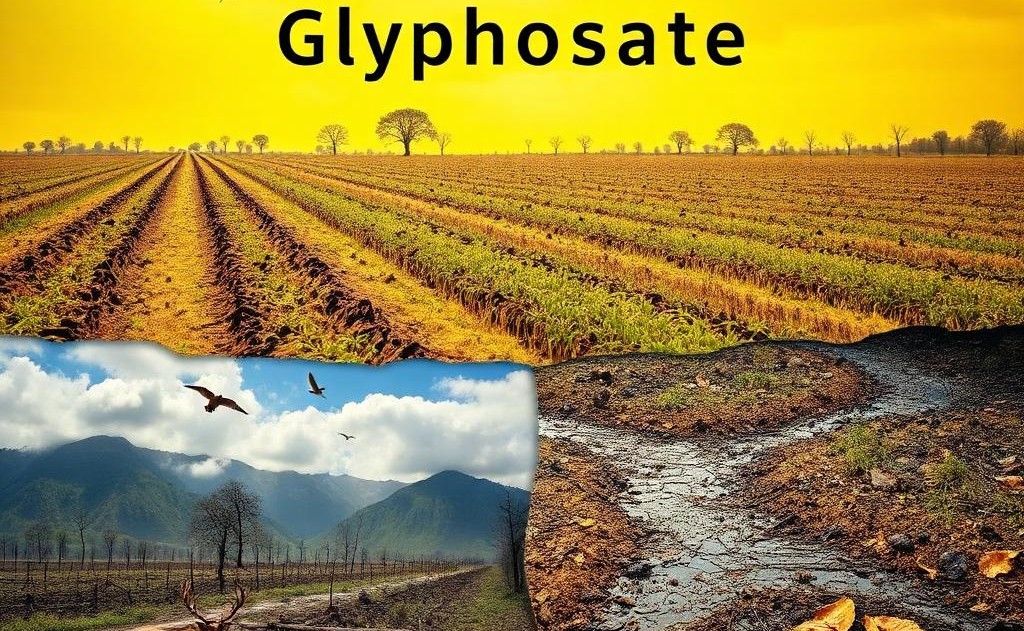
Kein Allheilmittel, aber einfach
Mole argumentiert, dass eine Möglichkeit, die Abhängigkeit von Glyphosat zu verringern, darin bestünde, seinen Einsatz einzuschränken und gleichzeitig Landwirten finanzielle Unterstützung zu gewähren, damit sie alternative Strategien zur Unkrautbekämpfung erkunden können. Letztlich sei er davon überzeugt, dass ohne solche Einschränkungen der Betrieb wie gewohnt weiterlaufen könne. „Ich war auf der Oxford Real Farming Conference und saß in einer Podiumsdiskussion neben einem Landwirt, und er sagte im Grunde: ‚Sehen Sie, wenn es da ist, werden wir es verwenden. Wenn es nicht da ist, werden wir etwas anderes finden‘“, erklärt Mole. „Das ist die Realität, es ist Bequemlichkeit.“
Bedenken hinsichtlich möglicher Ertragseinbußen
Allerdings bestehen Bedenken hinsichtlich möglicher Ertragseinbußen. Eine aktuelle Modellstudie legt nahe, dass ein völliger Wirkungsausfall oder ein Verbot von Glyphosat zu erheblichen Einkommenseinbußen in der Landwirtschaft führen könnte. Hauptsächlich aufgrund geringerer Ernteerträge und Gewinne. Allerdings sind die Ergebnisse nicht ganz einseitig. Glyphosatfreie Szenarien zeigten positive Ergebnisse, darunter eine Verringerung der durch Herbizide verursachten Umweltrisiken und eine Erhöhung der Vielfalt an Nutzpflanzen.
„Wenn wir in Dinge wie Bodengesundheit und Artenvielfalt investieren und diese auf landwirtschaftlichen Betrieben verbessern, werden die Vorteile über die Auswirkungen auf die Umwelt hinausgehen“, sagte Metcalfe, Mitautor der Studie.
Die Öffentlichkeit wendet sich gegen Glyphosat
Unabhängig davon, ob ein Verbot unmittelbar bevorsteht oder nicht, ist es möglicherweise die klügste Vorgehensweise, eine Industrie zu überdenken, die so stark von einem so umstrittenen Pestizid wie Glyphosat abhängig ist. Dies gilt insbesondere angesichts der Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit der Chemikalie. Im Jahr 2017 erhielt eine Europäische Bürgerinitiative europaweit große Unterstützung und sammelte mehr als 1 Million Unterschriften. Die Petition forderte ein Verbot von Glyphosat, eine Reform des Zulassungsverfahrens für Pestizide und die Festlegung verbindlicher EU-weiter Ziele zur Reduzierung des Pestizideinsatzes. „Es gibt viele starke Gefühle in der Öffentlichkeit in der EU und im Vereinigten Königreich. Es handelt sich also eher um eine politische Entscheidung als um alles andere“, fügte Mole hinzu.
Die Nuancen politischer Entscheidungen
Politische Entscheidungen – insbesondere solche zu etwas so Kontroversem wie Glyphosat – sind von Natur aus nuanciert und erfordern den Input aller Seiten, um einen ausgewogenen Ansatz zu gewährleisten. „Bei jeder Entscheidung, ob wir Glyphosat oder diese anderen derzeit verwendeten Chemikalien weiterhin verwenden sollen oder nicht, muss dies ein Prozess sein, der partizipativ sein muss und Landwirte ebenso einbeziehen muss wie Biodiversitätsforscher“, sagt Weidenmüller. „Ich möchte Entscheidungsträger dringend dazu auffordern, die verfügbaren Informationen und die Auswirkungen von Agrochemikalien nicht nur auf Insekten, sondern auch auf Vögel und alles andere zu berücksichtigen.“
Quelle: Chemistry World
Lesen Sie Auch: Bewertung der Risiken von Chemikalien ist ein komplizierten Prozess
Reservierung
Diese Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt, in einigen Fällen aus verschiedenen Informationsquellen. (Interpretations-) Fehler sind nicht ausgeschlossen. Aus diesem Text kann daher keine rechtliche Verpflichtung abgeleitet werden. Jeder, der sich mit diesem Thema befasst, hat die Verantwortung, sich mit der Sache zu befassen!
Hinweis
Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. Es ist daher möglich, dass der Artikel Fehler im Wortschatz, in der Syntax oder in der Grammatik enthält.